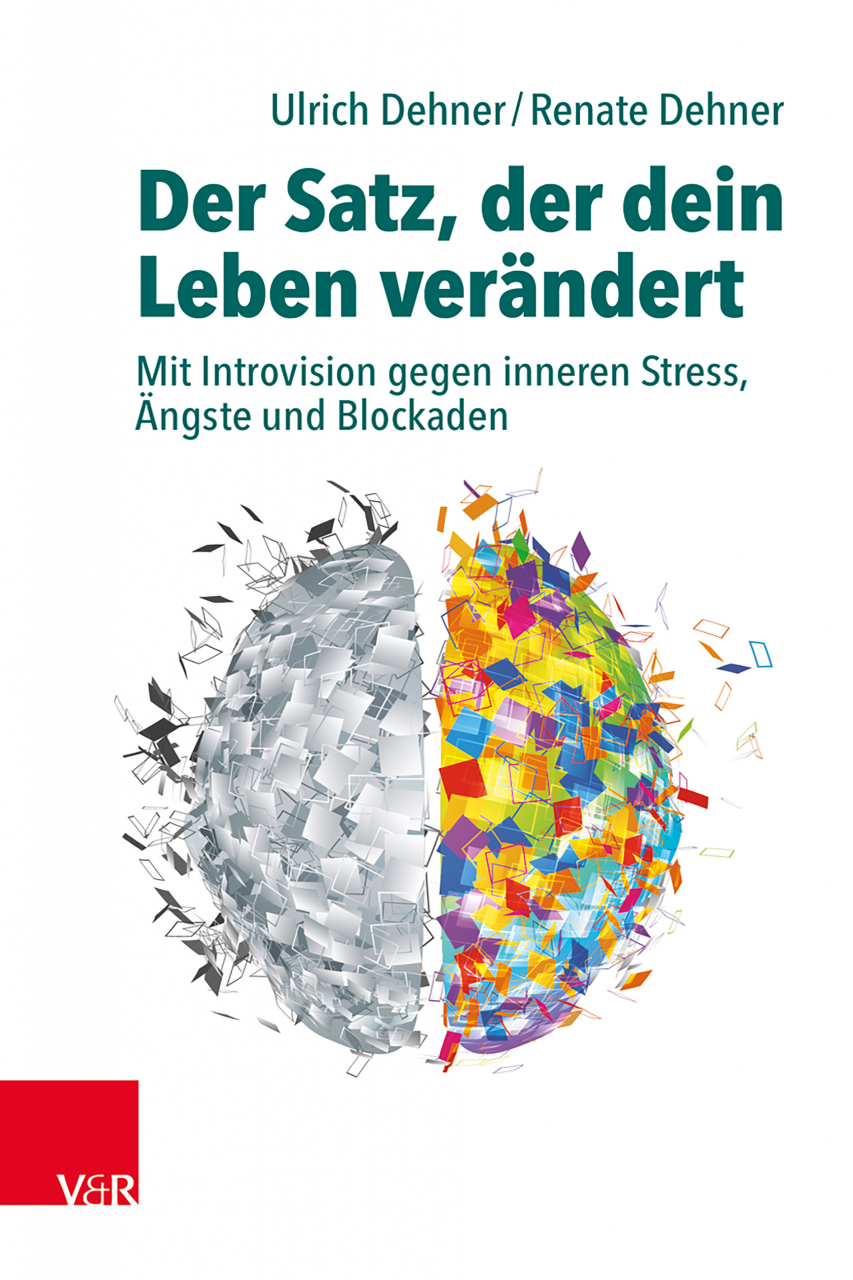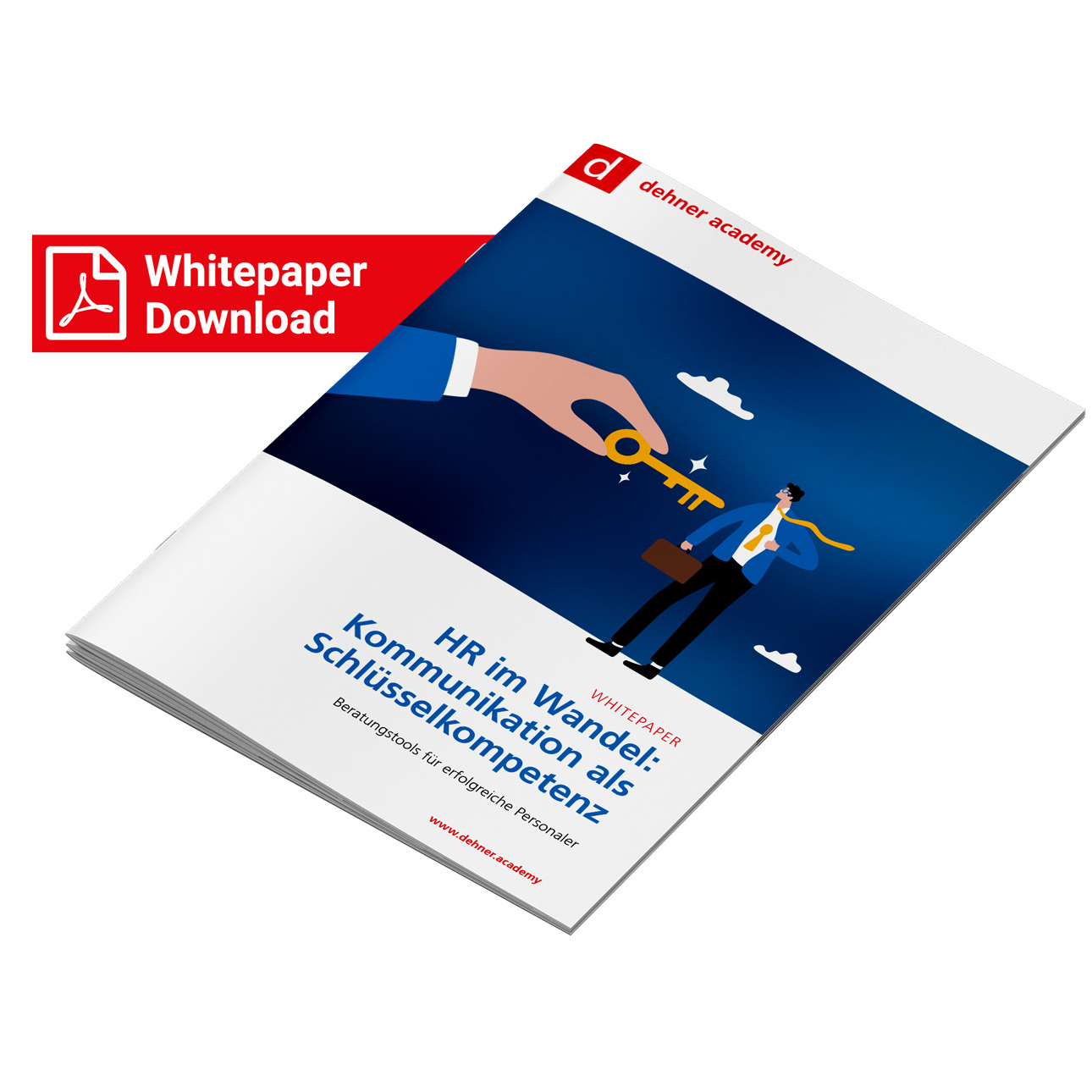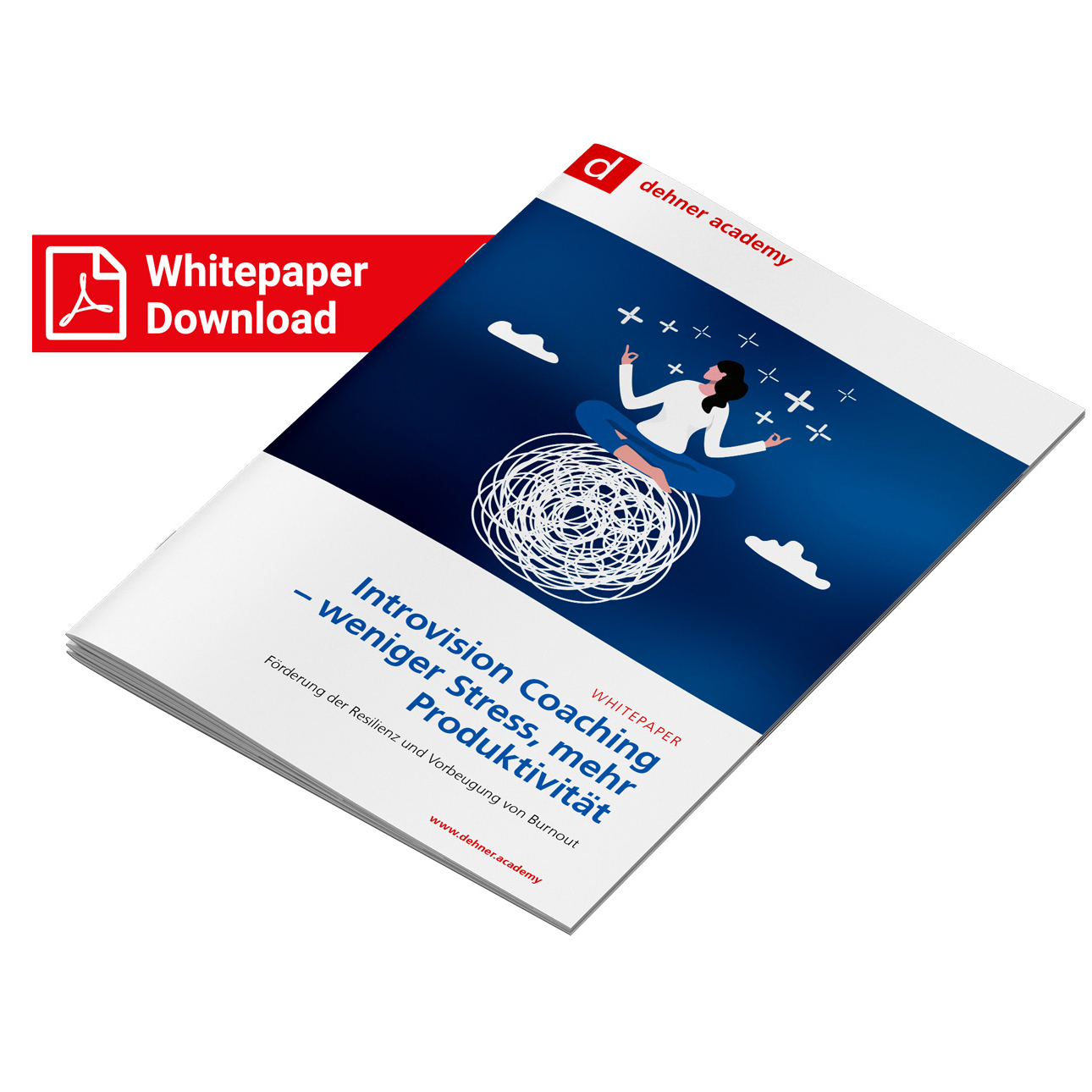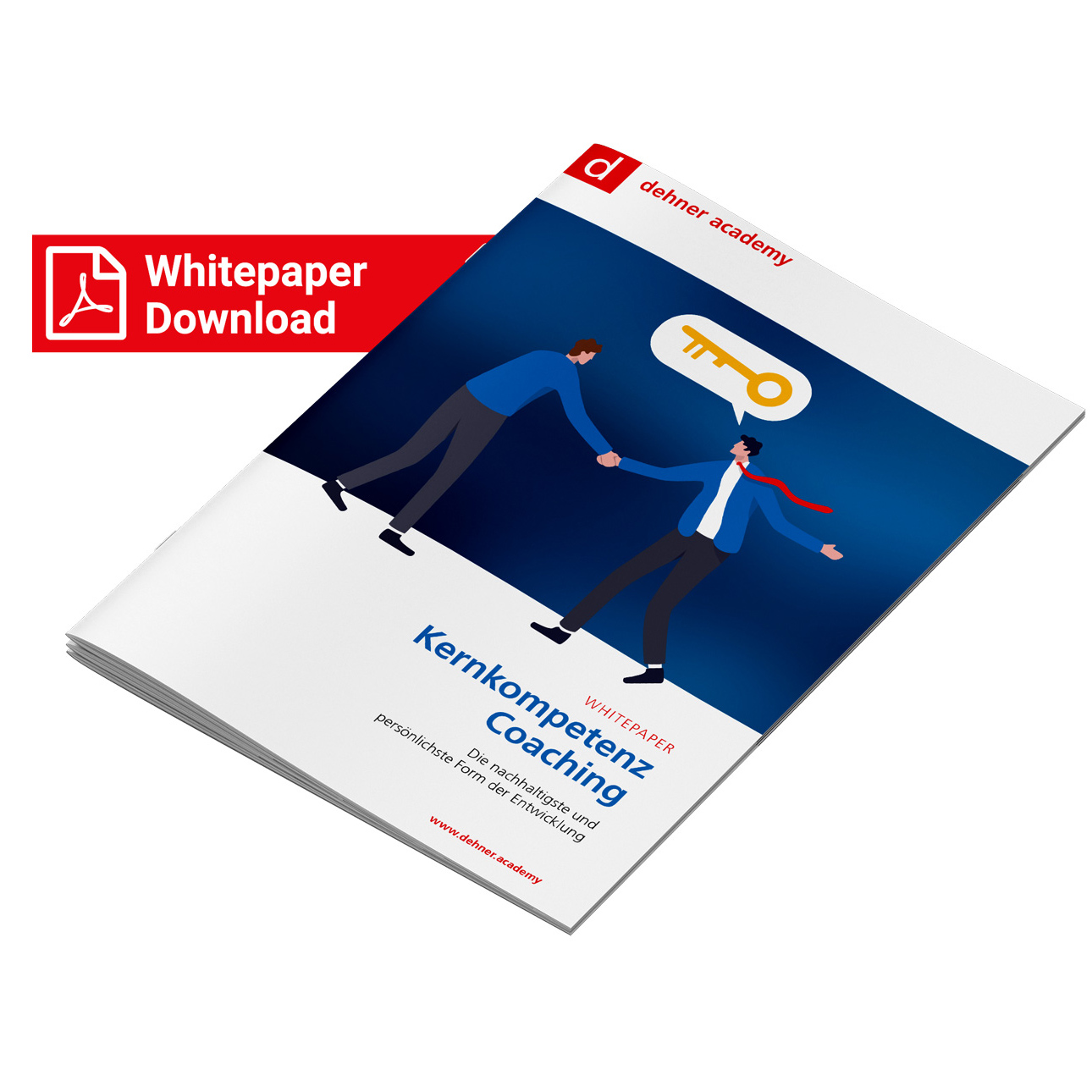Der tägliche Wahnsinn: alles auf den eigenen Schultern
Neulich im Coaching erlebt: Eine ambitionierte Führungskraft, erfolgreich, engagiert, ein echtes Vorbild. Sie hatte sich das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung erarbeitet. Doch mittlerweile war sie an einem Punkt angekommen, an dem der Druck überwog. Sie berichtete, dass sie regelmäßig Überstunden mache, weil sie „noch schnell“ ein paar Aufgaben zu Ende bringen müsse. Und auf das Thema Delegieren reagierte sie zwiegespalten: Sie wusste, dass es nötig ist. Dennoch fiel es ihr extrem schwer, Kontrolle abzugeben.
Die Angst, dass Aufgaben nicht richtig erledigt werden, dass am Ende mehr Zeit für Nachbesserungen draufgeht oder wichtige Themen aus dem Ruder laufen könnten, all das hielt sie davon ab, loszulassen. Lieber selbst machen, als sich auf andere verlassen. Lieber effizient wirken, als das Team zu entwickeln. Ein Trugschluss mit teuren Folgen.
Delegieren ist Führungsarbeit
Delegieren ist keinesfalls ein Zeichen von Schwäche oder Bequemlichkeit. Eher im Gegenteil: Es ist ein zentraler Bestandteil guter Führung. Wer delegiert, gewinnt auf mehreren Ebenen:
- eigene Ressourcen freisetzen: Zeit und Energie für strategisches Arbeiten gewinnen.
- Team stärken: Mitarbeitenden Verantwortung übertragen heißt auch, ihnen Vertrauen zu schenken.
- Überlastung vorbeugen: Führungskräfte, die alles selbst machen, brennen schneller aus.
- Unternehmen stabilisieren: Organisationen, die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen, sind anpassungsfähiger.
Dabei geht es nicht darum, einfach Arbeit abzuschieben. Gute Delegation heißt, Aufgaben sinnvoll zu übergeben, und zwar unter Berücksichtigung von Stärken, Entwicklungspotenzialen und Prioritäten.
Warum es trotzdem so schwerfällt
Ob im Coaching oder im Training: Viele Führungskräfte wissen theoretisch, wie Delegation funktioniert. In der Praxis stehen sie sich oft selbst im Weg. Typische Gründe:
- Perfektionismus: „Bevor ich alles erkläre, mach’ ich’s lieber schnell selbst.“
- unklare Prioritäten: Wenn nicht klar ist, was strategisch wichtig ist, wird alles zur Chefsache.
- fehlendes Vertrauen: Wer denkt, nur er selbst könne es „richtig“ machen, wird sein Team nie wachsen lassen.
- Schuldgefühle: Manche haben Hemmungen, Aufgaben abzugeben. Als wäre das ein Zeichen von Schwäche.
- Selbstwert über Fachlichkeit: Wer seine Rolle vor allem über seine Fachexpertise definiert, hat Angst, durch Delegation an Bedeutung zu verlieren.
Die Folge: Die Führungskraft wird zur besten Assistenz ihrer Mitarbeitenden. Aber nicht zur starken Führungskraft.
Gute Delegation beginnt mit den richtigen Fragen
Delegieren beginnt mit dem Nachdenken. Diese Fragen helfen bei der Einschätzung:
- Passt die Aufgabe besser zu den Zielen oder Kompetenzen eines Teammitglieds?
- Kann jemand im Team an der Aufgabe wachsen?
- Wird diese Aufgabe regelmäßig wiederkehren, lohnt sich also das Einlernen langfristig?
- Habe ich Kapazität, den Delegationsprozess zu begleiten (Erklärung, Feedback, ggf. Nachschärfen)?
- Ist die Aufgabe kritisch oder strategisch? Oder kann sie auch anders gelöst werden?
Man muss nicht jede Frage mit „Ja“ beantworten. Aber je öfter man sie reflektiert, desto klarer wird: Delegation ist eine Investition.
Schritt für Schritt Loslassen
Gerade wer sich mit Delegation schwertut, sollte nicht gleich mit dem größten Projekt beginnen. Klein anfangen, Vertrauen aufbauen. Wichtig dabei:
- Klarheit über Prioritäten schaffen: Was ist wirklich wichtig und was nicht?
- Stärken im Team kennen: Wer kann was gut? Wer will sich weiterentwickeln?
- Kontext und Zielbild kommunizieren: Nicht nur „was“, sondern auch „warum“ und „wohin“.
- Feedbackschleifen einbauen: Regelmäßige Updates und Rückfragen ermöglichen Orientierung, ohne Mikromanagement.
- Ergebnisse definieren, Wege freigeben: Rom muss klar definiert sein, wie man hinkommt, darf allerdings individuell sein.
Und am Ende: Wertschätzung. Eine Aufgabe ist erledigt? Dann sagen Sie es. Loben Sie. Zeigen Sie, dass Sie die Arbeit gesehen haben. Denn das motiviert und stärkt die Delegationskultur.
Führen heißt ermöglichen
Führung ist kein Ein-Mensch-Unternehmen. Dauerhaft Aufgaben bei sich zu behalten, verhindert Entwicklung, beim Team und bei sich selbst. Anstelle von Kontrolle um jeden Preis braucht es Vertrauen, Klarheit, Kommunikation und Mut zur Lücke. Und das Bewusstsein: Nicht jeder andere Weg ist schlechter. Nur anders. Hauptsache, am Ende ist Rom erreicht.
Wenn Sie also das nächste Mal denken: „Ich mach’ das schnell selbst“, halten Sie kurz inne. Und überlegen Sie: Wäre das nicht eigentlich eine perfekte Gelegenheit, Führung zu zeigen?
Delegieren fällt Ihnen schwer, und Sie wollen daran arbeiten?
Informieren Sie sich jetzt auf unserer Website über unsere Angebote oder vereinbaren Sie direkt ein unverbindliches Erstgespräch. Gemeinsam finden wir heraus, was Sie jetzt am besten unterstützt.
Wenn Sie mehr Impulse für Führungskräfte, Business Talk, Management-Input und Gedanken, die Unternehmen für die Zukunft stärken, möchten, dann hören Sie gerne in den Business-Podcast von Alice Dehner rein.